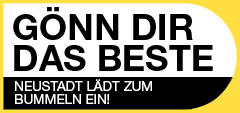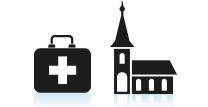Geheimnis hinter Gründungssage des Klosters Preetz gelüftet
Preetz (mm). Wie das Kloster Preetz entstanden ist, das erzählt eine sagenhafte Geschichte. Angeblich ist die Legende so alt wie das Kloster selbst. Tatsächlich ist sie eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Mit diesem überraschenden Forschungsergebnis verblüffte Professor Harm-Peer Zimmermann in der Winterkirche des Klosterhofs mit einem anspruchsvollen Vortrag unter dem Titel „Sagen vom Klosterhof“. Das Interesse war riesig, die Winterkirche platzte aus allen Nähten. Kein einziger, der dicht gestellten Stühle, war mehr frei. „So voll wie heute habe ich das höchstens mal an Weihnachten hier erlebt“, freute sich Christian Stocks, Vorstand der Freunde der Predigerbibliothek, der die Veranstaltung moderierte und Zimmermanns Vortrag lobte: „Das war ein Feuerwerk der Wissenschaft, gespickt mit einer Prise Humor.“
Tatsächlich ging es am Donnerstagabend um mehr als nur alte Geschichten aus dem Klosterhof, die der emeritierte Professor für Populäre Literaturen und Medien an der Universität Zürich, und selbst Bewohner des Klosterhofs, unter die Lupe nahm. Dabei stellte er drei Sagen vor, die der Germanist Karl Müllenhoff 1845 in seiner Sammlung schleswig-holsteinischer Volkserzählungen festgehalten hatte. Im Mittelpunkt stand die Sage über die Entstehung des Klosters Preetz.
Eigentlich liegt es nahe, die Sage in die Zeit der Klostergründung durch den Grafen von Orlamünde (Anfang des 13. Jahrhunderts) zurückzudatieren, da der Graf in Urkunden aus dieser Zeit namentlich erwähnt wird. Doch Zimmermann zündete die Überraschung des Abends: „Die Sage ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts.“ Sprache, Stil und Tonfall machten das deutlich. Karl Müllenhoff habe die Sage unter Berufung auf einen angehenden Pastor namens Rejahl im Stil der Brüder Grimm zusammengebastelt. „Eine Herkunft aus früheren Jahren wäre reine Spekulation“, brachte Zimmermann seine Forschungsergebnisse auf den Punkt. Das Publikum staunte. Offenbar hatten viele geahnt, dass der Abend spannend werden würde.
Zimmermann studierte Volkskunde, Soziologie und Geschichte in Kiel. Nach seiner Promotion lehrte und forschte er vor allem zu Märchen, Mythen und Sagen an den Universitäten Kiel, Marburg und Zürich. Kein Wunder also, dass er seine Ergebnisse akribisch darlegte. Für das Kloster Preetz seien nur drei Sagen belegt: „Der Donner holt ein Klosterfräulein“, „Die Weihnachtsfeier im Preetzer Kloster“ und „Die Stiftung des Klosters Preetz“. Zwar sei er auf einige weitere, kurze Fragmente gestoßen, doch würden ausführliche Überlieferungen fehlen. Die drei wichtigen Sagen wurden Mitte des 19. Jahrhunderts vom Kieler Germanisten und Volkskundler Karl Müllenhoff veröffentlicht. Spannend: Müllenhoff arbeitete damals eng mit zwei jungen Theologiestudenten namens Volbehr und Rejahl aus Kiel zusammen. Gemeinsam waren sie begeistert vom Werk der Brüder Grimm, die ihnen als Vorbild dienten und bei denen sie möglicherweise auch abgekupfert haben.
Schon eine kritische Beurteilung der ersten beiden Sagen zeigt das: In der ersten Sage wird ein Klosterfräulein zur Strafe vom Gewitter heimgesucht, die zweite rückt ein himmlisches Licht als Ermutigung zu Weihnachten in den Vordergrund. Haarklein sezierte Zimmermann Zeile für Zeile, verglich Versionen und kam zu dem Schluss: Trotz früherer Spuren stammen sie in ihrer jetzigen Form aus Müllenhoffs Feder beziehungsweise aus derjenigen seiner Gewährsleute Rejahl und Volbehr.
Noch spannender ist der Blick auf die Gründungssage. Schon die Unterzeile zu dieser Schlüsselsage ist aufschlussreich: „Mündlich vom Herrn cand. theol. Rejahl, vergleiche die St.-Hubertus-Legende.“ „Woher kommt diese mündliche Überlieferung?“, fragte Zimmermann mit süffisantem Ton. Zu diesem Zeitpunkt ahnte das Publikum noch nichts von der Enthüllung, die er sich als Sahnehäubchen für den Schluss aufgehoben hatte.
Bei der Entstehungssage für das Kloster Preetz handelt es sich wissenschaftlich um eine „Stiftungs-, Gründungs- und Bauplatzsage“. Solche Sagen antworten auf die Frage, warum ein Bauwerk ausgerechnet an dieser Stelle entstanden ist. Als Gründe werden stets übernatürliche Erscheinungen als „himmlische Weisungen“ angegeben. „Das lässt zwar auf einen Ursprung im Mittelalter schließen“, so Zimmermann. „Doch der Hirsch ist keinesfalls ein Preetzer Alleinstellungsmerkmal.“ Im Gegenteil: Wie der Rosenstock gehört er zu den wiederkehrenden Motiven christlicher Länder, von Spanien bis Norwegen. Der Hirsch taucht bis heute auf, etwa im Wappen von Nonnweiler oder auf Etiketten eines Kräuterschnapses. Erste Legenden mit dem Wildtier datieren bis in frühchristliche Zeit.
Schon im Psalm 42,3 heißt es: „Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser.“ Im Mittelalter wurde der Hirsch zum Bild für Jesus Christus. Und hat eine tiefe Bedeutung. Der Jäger ist in Wahrheit der Gejagte, ein Mensch, der nach innerem Frieden sucht und ihn nur in Christus findet. So erklärt sich auch die Legende von der Bekehrung des Hubertus, des Schutzpatrons der Jäger, auf den sich der erwähnte Rejahl bezieht.
Die Symbolik des Hirschs lässt sich bis ins „Hohe Lied“ zurückverfolgen. Dort ist von einem Hirsch die Rede. Ursprünglich ein Sinnbild für das Volk Israel, wurde der Hirsch im frühen Christentum auch Symbol für Kirche, Seele oder Muttergottes. „Für protestantische Ohren klingt das suspekt“, meinte Zimmermann, „doch viele Darstellungen greifen diese Symbolik auf“. Sie tun das vielfach im Zusammenhang mit Frauen, die einen vorbildlichen Lebenswandel führen. Zu sehen sei das etwa in Zürich. Nicht so in Preetz.
Damit schlug Zimmermann den Bogen in die vorreformatorische Zeit. Die Spur führt nach Lübeck, wo eine sehr ähnliche Sage existiert. Eine mehr als 400 Jahre alte Illustration zeigt Herzog Heinrich den Löwen, der einen kapitalen Hirsch jagt. Plötzlich hält der Hirsch inne und in seinem Geweih erscheint ein goldenes Kreuz, sodass Heinrich an genau dieser Stelle den Lübecker Dom errichten lässt. Die Ähnlichkeit mit der Preetzer Sage ist verblüffend. In beiden sind nicht Heilige, sondern weltliche Herrscher die Protagonisten. Die Lübecker Sage ist es, die im 19. Jahrhundert von dort nach Preetz gewandert ist. Lediglich die Protagonisten wurden ausgetauscht: Graf Albrecht in Orlamünde tritt an die Stelle von Heinrich dem Löwen.
Im Klosterhof endete der Abend voller historischer Erkenntnisse unter großem Beifall. Die Veranstaltung unterstrich eindrucksvoll, dass Preetz ein lebendiges Interesse an seiner Geschichte hat. Zum Abschluss öffnete Christian Stocks noch die schweren Türen zur renovierten Predigerbibliothek. Es war ein trefflich gewählter Schlusspunkt für einen außergewöhnlichen Abend.
Wer selbst in die „Sagen, Märchen und Lieder der Herzogthümer Schleswig, Holstein und Lauenburg“ eintauchen möchte, findet sie online auf www.digitale-sammlungen.de.

Richtfest für die Offene Ganztagsschule

B 76-Sperrung: Nur Lkw-Verkehr macht Sorgen

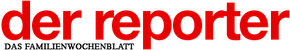



 Zurück
Zurück
 Nach oben
Nach oben