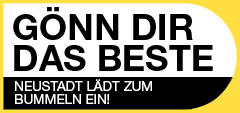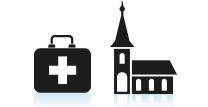Die Geschichte
Der Erste Weltkrieg, der angesichts der bis dahin unvorstellbar grauenvollen Verhältnisse bereits von Zeitgenossen als „Urkatastrophe für die Menschheit“ bezeichnet worden ist, war gerade beendet, als ein Stuttgarter Zigarettenfabrikant die Idee von einer alternativen Schulform entwickelte.
Emil Molt, Inhaber der Waldorf-Astoria Zigarettenfabriken, stellte sich in erster Linie ein System vor, in dem die Kinder nicht bereits früh nach Lernleistungen und -vermögen selektiert in unterschiedlichen Schulformen unterrichtet würden. Da Emil Molt der Anthroposophie sehr zugetan war, nahm er Kontakt zu Rudolf Steiner auf, von dem er wusste, dass dieser sich bereits im frühen 20. Jahrhundert intensiv mit der „Entwicklung des Kindes vom Standpunkt der Menschenkunde“ auseinandergesetzt hat. Steiner sollte, so der Wunsch Emil Molts, auf der Grundlage der von ihm entwickelten Menschenkunde einen Lehrplan entwickeln, der sich nicht an den vom Staat oder der Wirtschaft formulierten Leistungskriterien, sondern vielmehr an den Entwicklungsphasen des heranwachsenden Menschen orientiert, einen möglichst breiten Bildungsansatz verfolgt und nicht zuletzt gewährleistet, dass die Kinder und Jugendlichen ihr auf 12 Jahre ausgerichtetes Schulleben in einem Klassenverband mit allen Höhen und Tiefen gemeinsam bestreiten.
In wenigen Monaten, nämlich bis zum September 1919, gelang es Rudolf Steiner, nicht nur zahlreiche rechtliche, wirtschaftliche und andere Hürden zu überwinden. Vor allem ist es heute nahezu unvorstellbar, dass er es geschafft hat, für eine noch nicht existierende Schule ein Lehrerkollegium zusammenzustellen, das in der neuen Schulform den Unterricht erteilen sollte. Dazu war es erforderlich, den Lehrern im Rahmen einiger intensiver Konferenzen das für sie komplett neue pädagogische System zu erläutern. Dies gelang und so kam es, dass die erste Waldorfschule am 7. September 1919 in Stuttgart, in einer umgebauten ehemaligen Gaststätte, ihren Betrieb aufnehmen konnte.
Die erste Waldorfschule war keine „reformpädagogische Eintagsfliege“ wie es viele Zeitgenossen vermuteten oder sich vielleicht auch gewünscht haben mögen. Sie entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten vielmehr zu einer kraftvollen Bewegung, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg in zahlreichen Städten Deutschlands sowie des europäischen Auslandes zu Schulgründungen animierte. Auch das Verbot der Waldorfschulen durch die Nationalsozialisten hat der Bewegung letztendlich nichts anhaben können, denn nach 1945 wurden die zwangsweise stillgelegten Schulen wieder eröffnet beziehungsweise weitere neu gegründet. Heute sind die Waldorfschulen und die anderen an der sogenannten Menschenkunde Rudolf Steiners ausgerichteten pädagogischen Einrichtungen aus den Schullandschaften zahlreicher Staaten nicht mehr wegzudenken. (red)
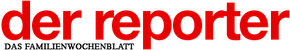

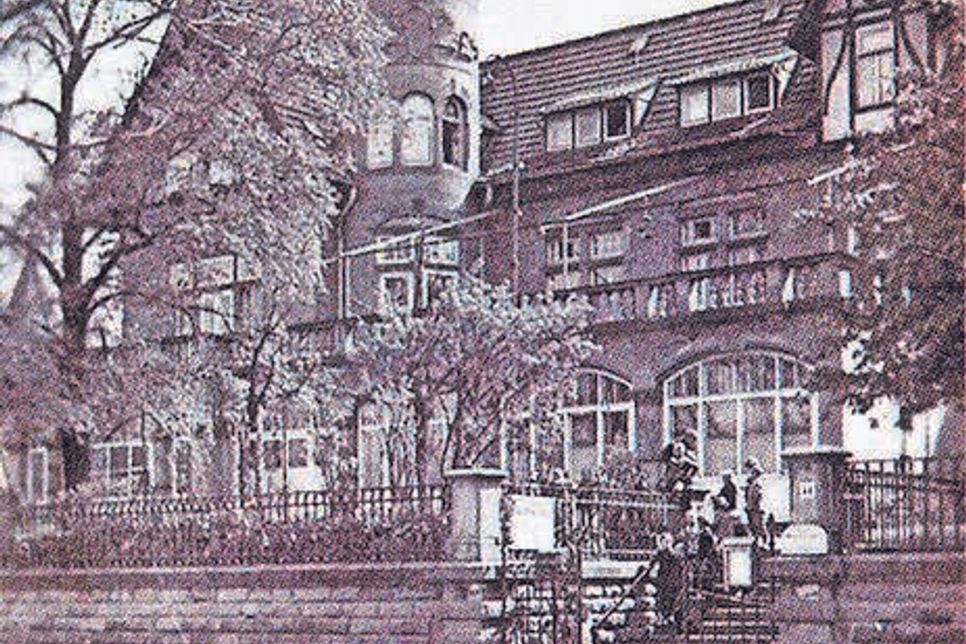
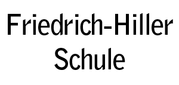


 Zurück
Zurück
 Nach oben
Nach oben